Das Wichtigste zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Kürze
Jeder Einzelne hat das Recht, selbst zu über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu entscheiden.
Als wichtiges Datenschutz-Grundrecht wurzelt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Eine ausführliche Erklärung finden Sie hier.
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung spielt zum Beispiel bei staatlichen Überwachungsmaßnahmen wie der immer wieder diskutierten Vorratsdatenspeicherung eine wichtige Rolle.
Was umfasst das Recht auf informationelle Selbstbestimmung? Definition & Schutzbereich

Inhaltsverzeichnis
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bezeichnet in Deutschland das Recht eines jeden, selbst darüber zu entscheiden, ob und wie seine personenbezogenen Daten preisgegeben und verwendet werden sollen. Damit bildet es die entscheidende Grundlage für den Datenschutz und spielt in vielen Lebensbereichen eine sehr zentrale Rolle.
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird im GG (Grundgesetz) nicht ausdrücklich erwähnt, sondern entstammt dem berühmten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983. Das BVerfG erkennt dieses Recht als eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nach Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 GG an.
Es schützt Menschen davor, dass ihre persönlichen Daten unbegrenzt gesammelt, gespeichert oder weitergegeben werden. Vielmehr darf jeder selbst entscheiden, ob und welche Informationen er über sich preisgibt und wie diese verwendet werden. Außerdem hat jeder Betroffene das Recht zu erfahren, wer was und zu welcher Gelegenheit über ihn erfährt bzw. weiß.
Dieser Schutz umfasst grundsätzlich alle Informationen, die sich einer bestimmten Person zuordnen lassen, z. B.:
- Name, Geburtstag und -ort
- Wohnanschrift und Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Benutzernamen, Kundennummern
- Standortdaten & Bewegungsprofile
- IP-Adresse & Geräteerkennungen
- Familienstand
- Religion & Weltanschauung
- sexuelle Orientierung
- politische Ansichten
- Gesundheitsdaten
- Einkommensverhältnisse
Recht auf informationelle Selbstbestimmung: Das BVerfG und sein Volkszählungsurteil
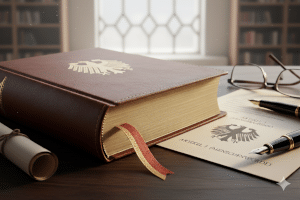
Wie bereits erwähnt, geht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung auf das Volkszählungsurteil von 1983 zurück – einem Meilenstein in der Entwicklung des Datenschutzes.
Anlass für diese Grundsatzentscheidung war eine für dieses Jahr geplante Volkszählung auf der Grundlage des damaligen Volkszählungsgesetzes. Die Bundesregierung wollte alle Einwohner statistisch erfassen, unter anderem um herauszufinden, wo Handlungsbedarf im Wohnungs- und Straßenbau oder anderen Bereichen besteht.
Dabei handelte es sich aber nicht nur um eine reine Kopfzählung, sondern um eine sehr persönliche „Zwangsbefragung“, bei der z. B. auch die Staatsangehörigkeit, Wohnsituation, der Familienstand, Einkommensverhältnisse, Berufsleben und berufliche Qualifikation, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Zugehörigkeit zu einer Religion erfasst werden sollten.
Dagegen wurden mehrere Verfassungsbeschwerden erhoben. In seinem Grundsatzurteil etablierte das Bundesverfassungsgericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung – abgeleitet aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der verfassungsrechtlich geschützten Menschenwürde. Damit standen die Richter jedem Menschen das Recht zu, selbst zu entscheiden, wer welche personenbezogenen Daten erhebt, speichert, verwendet oder weitergibt.
Einschränkungen dieses Rechts sind laut BVerfG nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Dafür ist eine verfassungsgemäße Gesetzesgrundlage erforderlich. Außerdem muss der Gesetzgeber den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten.
Wo endet das Recht auf informationelle Selbstbestimmung? Schranken

Wie jedes andere Grundrecht hat auch das informationelle Selbstbestimmungsrecht Grenzen. Der Staat darf personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, wenn dieser Eingriff durch ein Gesetz verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.
Das BVerfG hat die Anforderungen an die Rechtfertigung eines Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wie folgt präzisiert:
- Der Gesetzgeber muss Gesetze zur Datenverarbeitung klar und präzise formulieren. Damit jeder nachvollziehen kann, wie seine Daten genutzt werden, müssen Zweck, Anlass und Grenzen eines Eingriffs eindeutig im Gesetz festgelegt werden.
- Die erhobenen Daten dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie ursprünglich erhoben wurden (Grundsatz der Zweckbindung).
- Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzuordnen sind, stehen unter einem besonderen Schutz. Hierzu gehören zum Beispiel Tagebuchaufzeichnungen über Gedanken, Gefühle und höchstpersönliche Erlebnisse. Sollen Daten dürfen möglichst erst gar nicht erhoben werden – was sich aber bei heimlichen Überwachungsmaßnahmen kaum vermeiden lässt. Deshalb müssen solche Daten unverzüglich gelöscht und dürfen nicht verwertet werden.
- Zu guter Letzt muss der Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verhältnismäßig sein. Das heißt, er ist nur erlaubt, wenn er einem legitimen Zweck dient sowie geeignet, erforderlich und angemessen ist.
Was bedeutet das Recht auf informationelle Selbstbestimmung für Unternehmen?

Nicht nur der Staat, auch private Unternehmen erheben und verarbeiten persönliche Daten, zum Beispiel …
- im Rahmen der Vertragsabwicklung,
- zur Prüfung der Kreditwürdigkeit,
- um personalisierte Werbung schalten zu können,
- zum Zweck der Marktforschung oder
- für statistische Zwecke.
Doch auch sie müssen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung beachten, indem sie sich an die Regeln der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einhalten. Das bedeutet unter anderem Folgendes:
- Für die Datenerfassung ist eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen oder eine anderweitige Rechtsgrundlage erforderlich.
- Die erhobenen Daten dürfen nur für den zuvor festgelegten und mitgeteilten Zweck verarbeitet werden.
- Jedes Unternehmen muss seinen Informationspflichten nachkommen und z. B. eine korrekte Datenschutzerklärung auf seiner Webseite zur Verfügung stellen.
Recht auf informationelle Selbstbestimmung in der DSGVO
Zur Durchsetzung des informationellen Selbstbestimmungsrechts sieht die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ganz konkrete Betroffenenrechte vor, beispielsweise:
- Auskunftsrecht darüber, ob und wie das Unternehmen personenbezogene Daten verarbeitet
- Recht auf Berichtigung persönlicher Daten, wenn diese falsch, veraltet oder unvollständig sind
- Recht auf Löschung der eigenen persönlichen Daten
- Recht, von einem datenverarbeitenden Unternehmen die Einschränkung dieser Datenverarbeitung zu verlangen
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten
- Recht, die Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen

Schreibe einen Kommentar